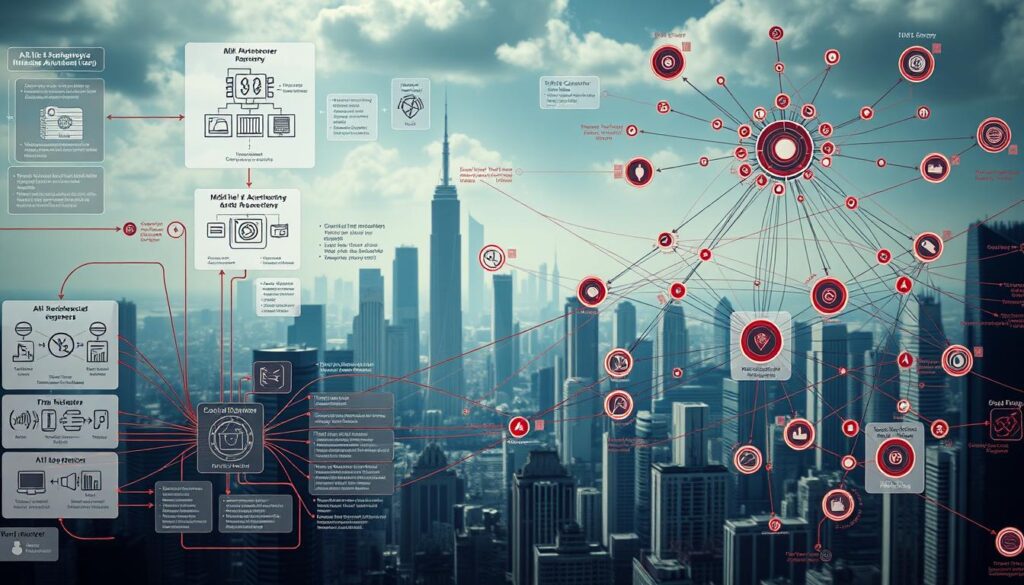KI Verordnung: Alles über neue KI Regulierung

Verordnung (EU) 2024/1689 schafft einen einheitlichen Rahmen für künstliche Intelligenz in der EU. Das Gesetz wurde am 12.07.2024 veröffentlicht und ist seit dem 01.08.2024 in Kraft. Bestimmte Verbote nach Art. 5 gelten seit dem 02.02.2025, während viele Vorschriften ab dem 02.08.2026 greifen.
Diese Seite liefert kompakte Informationen zur Zielsetzung, Definition (Art. 3) und Einordnung der Technologie. Wir erklären, welche Systeme als hochriskant gelten (Kapitel 3, Art. 6–49) und wie Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI, Art. 51–56) reguliert werden.
Der Fokus liegt auf praktischen Schritten: wer betroffen ist, welche Rollen das Regelwerk unterscheidet und welche Compliance‑Prioritäten jetzt wichtig sind. Außerdem nennen wir Pflichten wie die Schulung nach Art. 4 und die zuständigen Stellen auf EU‑ und nationaler Ebene.
Wesentliche Erkenntnisse
- EU‑Regelwerk 2024/1689 setzt klare Ziele für eine sichere, menschenzentrierte Einführung.
- Art. 3 liefert die zentrale Definition, Art. 5 regelt verbotene Praktiken.
- Hochrisiko‑Pflichten gelten umfassend ab 02.08.2026.
- Schulungspflicht nach Art. 4 gilt bereits seit 02.02.2025.
- Der Beitrag zeigt praktische Compliance‑Schritte für Unternehmen und Behörden.
Was die KI‑Verordnung jetzt bedeutet: Definition, Ziele und zeitlicher Rahmen
Dieser Abschnitt erklärt die rechtliche Grundlage, den Zweck und den Zeitplan, die die Einführung von künstliche Intelligenz in der EU steuern.
Rechtsgrundlage und Definition gemäß Artikel 3
Art. 3 liefert eine technologieoffene Definition. Sie umfasst maschinengestützte Systeme mit unterschiedlichem Autonomiegrad, die Eingaben verarbeiten, um Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen zu erzeugen.
Solche Systeme können physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen. Die Festlegung bleibt weit genug, um neue Verfahren abzudecken.
Zweck der Verordnung: menschenzentrierte, sichere und innovative KI
Art. 1 legt den Zweck fest: Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Grundrechten bei gleichzeitiger Förderung von Innovation.
Die Regelung schafft Vorhersehbarkeit durch klare Pflichten entlang des Lebenszyklus eines Systems.
- Schutz für Menschen und Grundrechte.
- Förderung sicherer Markteinführung und fairer Wettbewerb.
- Transparenzpflichten zur Bewertung des Risikos.
| Datum | Meilenstein | Relevanz |
|---|---|---|
| 01.08.2024 | Inkrafttreten (Art.113) | Gilt als Startpunkt für Pflichten |
| 02.02.2025 | Verbote gemäß Art. 5 | Unzulässige Praktiken sind untersagt |
| Januar 2025 / April 2025 | Interne Planung und Behördenklärung | Vorbereitung auf Pflichten und Zuständigkeiten |
| August 2026 | Breite Anwendung wichtiger Vorschriften | Hochrisiko‑Pflichten und Transparenz treten umfassend in Kraft |
Anwendungsbereich und Rollen: Für wen die Verordnung künstliche Intelligenz gilt
Dieser Abschnitt zeigt klar, für welche Akteure die neue Regelung gilt und welche Ausnahmen bestehen.
Geltungsbereich gemäß Art. 2: Die Regelung trifft Anbieter, Betreiber, Einführer, Händler, Produkthersteller und betroffene Personen entlang des gesamten Lebenszyklus von Systemen.
Privatpersonen sind ausgenommen, sofern die Nutzung rein privat bleibt. Ebenfalls ausgenommen sind reine Forschungs‑ und Entwicklungsprojekte sowie militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen.
Rollen im Überblick
Art. 16–27 differenziert Pflichten nach Rolle. Anbieter tragen Konformitäts‑ und Dokumentationspflichten sowie CE‑Kennzeichnung und Registrierung. Betreiber überwachen Nutzung, beachten Nutzungsvorgaben und melden Vorfälle.
„Klare Rollenverteilung entlang der Wertschöpfungskette ist zentral für rechtssichere Umsetzung.“
| Rolle | Hauptpflicht | Rechtsgrundlage (Art.) | Praxishinweis |
|---|---|---|---|
| Anbieter | Konformität, Techn. Dokumentation | Art. 16–19 | CE‑Kennzeichnung, Registrierung |
| Betreiber | Betrieb, Überwachung, Meldung | Art. 20–22 | Interne Einsatzregeln erstellen |
| Einführer / Händler | Sicherstellung konformer Inverkehrbringung | Art. 23–27 | Prüfung Lieferkette |
Räumliche Reichweite: Auch außereuropäische Anbieter unterliegen den Regeln, wenn Systeme oder deren Ergebnisse in der EU verwendet werden. Auf nationaler Ebene benennen Mitgliedstaaten zuständige Behörden und zentrale Anlaufstellen (Art. 70). Die Kommission kann die Liste der hochriskanten Anwendungsfälle anpassen.
Risikoansatz und verbotene Praktiken: Rahmen, Definitionen und Liste gemäß Artikel 5
Die Verordnung trennt klare Risikoebenen und benennt eine Liste verbotener Praktiken nach Art. 5. Das Ziel ist, Menschen und Personen vor schwerwiegenden Schäden zu schützen.
Verbotene Praktiken nach Art. 5
Art. 5 untersagt unter anderem kognitive Verhaltensmanipulation, Ausnutzung von Schwächen, Social Scoring und individualisiertes predictive policing gegenüber Einzelpersonen.
Außerdem verbietet die Regel massenhaftes Scraping von Gesichtsbildern zur Datenbankerstellung, Emotionserkennung in Jobs oder Schulen sowie biometrische Kategorisierung auf Basis sensibler Daten.
Risikoklassen und Folgen für Anwendungen
- Unvertretbar (verboten): direkte Eingriffe, die Grundrechte verletzen.
- Hoch: Systeme mit hohem Schadenpotenzial benötigen strenge Kontrollen.
- Begrenzt: z. B. Chatbots — Transparenzpflichten nach Art. 50.
- Minimal: geringe Risiken, normale Grundsätze gelten.
| Kategorie | Beispiel | Wichtige Folge |
|---|---|---|
| Unvertretbar | Social Scoring | vollständiges Verbot (Art. 5) |
| Hochrisiko | Gesundheitsdiagnose | Risikomanagement, Prüfungen |
| Begrenzt | Chatbot | Transparenzpflicht (Art. 50) |
| Minimal | Spam‑Filter | keine speziellen Pflichten |
Leitlinien der Kommission konkretisieren die Auslegung. Anbieter und Betreiber sollten Anwendungen regelmäßig prüfen, ob sie in eine andere Kategorie fallen, da dies Pflichten und Kontrollebenen bestimmt.
Hochrisiko‑KI‑Systeme: Anforderungen, Pflichten und Konformität
Bei hochrisiko‑KI‑Systemen gelten strenge technische und organisatorische Vorgaben, die Hersteller und Betreiber beachten müssen.
Risikomanagement und Daten‑Governance sind zentral: gemäß Artikel 8–15 sind Risikomanagement (Art. 9), Datenqualität (Art. 10) und technische Dokumentation (Art. 11) verpflichtend.
Protokollierung (Art. 12) und Informationspflichten gegenüber Betreibern (Art. 13) schaffen Nachvollziehbarkeit.
Pflichten entlang der Wertschöpfungskette
Anbieter müssen ein Qualitätsmanagementsystem (Art. 17) betreiben und Aufbewahrungspflichten erfüllen (Art. 18–19).
Weitere Rollen sind Bevollmächtigte (Art. 22), Einführer und Händler (Art. 23–24) sowie Betreiber (Art. 26). Art. 25 präzisiert Verantwortlichkeiten.
Konformität und Registrierung
Vor der Inverkehrbringung ist eine Konformitätsbewertung (Art. 43) durchzuführen. Es folgen EU‑Konformitätserklärung, CE‑Kennzeichnung (Art. 47–48) und Registrierung in der EU‑Datenbank (Art. 49).
Die Grundrechte‑Folgenabschätzung (Art. 27) ergänzt technische Kontrollen um rechtliche Prüfungen.
Praktische Hinweise: Leitlinien und harmonisierte Normen (Art. 40–41) erleichtern die Durchführung. Beachten Sie, dass zentrale Pflichten ab dem 02.08.2026 gelten; Kernpflichten zur Kompetenz und Verbote liefen bereits seit 02.02.2025.
KI‑Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI): systemische Risiken, Pflichten und Leitlinien
GPAI‑Modelle verlangen besondere Aufmerksamkeit, weil ihr Effekt auf Märkte und Infrastruktur groß sein kann. Kapitel 5 definiert das Prüfverfahren und die Kriterien zur Einstufung als Modell mit systemischem Risiko (Art. 51–52).
Einstufung als GPAI mit systemischem Risiko und Verfahren
Modelle werden nach Art. 51–52 bewertet. Ein formelles Verfahren legt fest, ob ein Modell systemische Risiken trägt. Danach gelten erweiterte Berichtspflichten und Meldeprozesse.
Pflichten der Anbieter von GPAI‑Modellen und Bevollmächtigte
Anbieter müssen Art. 53 erfüllen: Governance, Transparenz zu Trainingsdaten und robuste Sicherheitsmaßnahmen. Bevollmächtigte nach Art. 54 koordinieren Marktkommunikation und Compliance.
Verhaltenskodex und Praxisleitfäden der Kommission
Art. 56 sieht Praxisleitfäden und einen Verhaltenskodex vor. Diese Dokumente sollen den Rahmen für freiwillige und verpflichtende Maßnahmen klären.
Aktuelle Leitlinien und Entwicklungen 2025 für GPAI
Das AI‑Office veröffentlichte im April 2025 vorläufige Hinweise. Im Juli 2025 folgten Leitlinien‑Entwürfe und ein Code‑of‑Practice. Das gremium unabhängiger Sachverständiger (Art. 68) berät die Kommission bei der Einschätzung systemischer Risiken.
- Prüfung von Schnittstellen zu hochrisiko -ki-systeme ist notwendig.
- Anbieter ki-modellen sollten Governance und Dokumentation sofort anpassen.
Governance, Aufsicht und Durchsetzung auf EU‑ und nationaler Ebene
Die praktische Umsetzung des Rahmens wird durch mehrere Instanzen koordiniert. Auf EU‑Ebene übernehmen das AI Office (Art. 64) und das Europäische Gremium (Art. 65–69) die Festlegung und die Durchführung zentraler Vorgaben.
EU‑Gremien und wissenschaftliche Beratung
Das Europäische Gremium bündelt Expertise und gibt Leitlinien vor. Ein gremium unabhängiger Sachverständiger (Art. 68) berät insbesondere bei GPAI‑ und systemischen Risikofragen.
Zuständige nationale Behörden, Marktüberwachung und Datenbank
Mitgliedstaaten benennen zuständige behörden und zentrale Anlaufstellen (Art. 70). Die EU‑Datenbank für Hochrisiko‑Systeme (Art. 71) schafft Transparenz über registrierte Systeme.
Marktüberwachungsbehörden erhalten erweiterte Befugnisse (Art. 74–84). Die Aufsicht umfasst auch Tests in realen Umgebungen (Art. 76) und grenzüberschreitende Koordination.
Meldung von Vorfällen, Rechte und Sanktionen
Anbieter müssen strukturiert informationen bereitstellen und schwerwiegende Vorfälle melden (Art. 73). Betroffene personen haben Rechte auf Beschwerde (Art. 85) und individuelle Erläuterung (Art. 86).
Whistleblowing‑Mechanismen (Art. 87) stärken die Durchsetzung. Für GPAI gelten spezielle Instrumente zur Kontrolle und Anordnung (Art. 88–94).
Sanktionen nach Art. 99–101 richten sich nach Schwere und Art der Verstöße. Die Kommission koordiniert Leitlinien; 2024/2025 wurden Aufgabenlisten und Zeitpläne veröffentlicht, während nationale Umsetzungspläne derzeit erarbeitet werden.
- Wichtig: Anbieter sollten frühzeitig nationale Meldekanäle und Zuständigkeiten klären, um Fristen bei der Durchführung einzuhalten.
Fazit
, künstliche intelligenz braucht klaren, praktikablen Schutz. Die Verordnung schafft einen Rahmen mit dem Ziel, Innovation und Grundrechte zu verbinden.
Praxisnah sollten anbieter und unternehmen Risiko‑Analysen priorisieren und eine umfassende liste der eingesetzten systeme anlegen. So erkennen Sie früh, welche Anwendungen hochrisiko und welche minimal risiken bergen.
Richten Sie Prozesse für Dokumentation, Tests und menschliche Aufsicht ein. Beachten Sie die Eckdaten: In Kraft seit 01.08.2024, Verbote und Kompetenzpflichten seit 02.02.2025, zentrale Pflichten ab 02.08.2026.
Anbieter ki-modellen sollten die Leitlinien aus April 2025 und die Code‑of‑Practice‑Entwürfe eng verfolgen. Behörden und interne Teams brauchen klare Empfehlungen, Verantwortlichkeiten und Prüfpfade, um Risiken zu steuern.